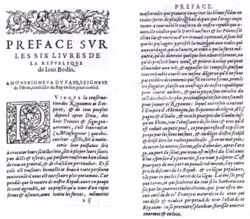
Jean Bodin: Les six livres de la République
Das Herrschaftsverständnis des Mittelalters sorgte seit eh und je zu widerstreitenden Ansprüchen zwischen Kirche und König; durch die Reformation und den Behauptungswillen ihrer Anhänger wurde die Lage dann noch unübersichtlicher und die starke Stellung des Hochadels tat ein Übriges. Adlige, Katholiken, Protestanten und der König, sie alle strebten nach Macht und sahen sich jeweils im Recht. Aus Sicht des Papstes betrieben die Reformatoren eine Spaltung der christlichen Glaubensgemeinschaft, wogegen Hugenotten und Lutheraner die katholische Kirche längst vom in der Bibel vorgegebenen Pfad abgekommen sahen; gegen beide strebte der König seine Herrschaft über das Land durchzusetzen, wodurch sich die Fürsten aber nicht ihrer alten Rechte berauben lassen wollten. Und sie alle kämpften längst mit jenen Methoden, die von Machiavelli niedergeschrieben und Caterina in die Wiege gelegt wurden. Die Folgen waren Kampf, Krieg, Intrigen und viel Leid in der Bevölkerung.
Jean Bodin sah in seinen 1576 veröffentlichten Sechs Bücher über den Staat (französisch: Les six livre de la République) nur eine Lösung: Im Staat dürfe es nur eine Instanz geben, die rechtmäßig die Herrschaft für sich beanspruchen kann. Genau genommen sprach Bodin nicht vom Staat, sondern von der Republik. Nicht, dass er überzeugter Republikaner gewesen wäre, vielmehr vermied er den Begriff der Monarchie, um mit eben jener überlieferten Ordnung zu brechen, die für ihn der Grund allen Übels war. Von einem Staat zu sprechen, war ihm aber noch nicht möglich, weil sich der Begriff für eine solche selbständige politische Einheit erst herauskristallisierte – nicht zuletzt im Gefolge seiner eigenen Überlegungen. Bodin verwendet deshalb jenen Begriff, den er von den Römern kannte.
„Unter dem Staat [im französischen Original: république] versteht man die am Recht orientierte, souveräne Regierungsgewalt über eine Vielzahl von Haushaltungen und das, was ihnen gemeinsam ist.“ (Bodin 1981, S. 98)
So sehr dieser Satz demjenigen auch ähneln mag, mit dem Marcus Tullius Cicero 1600 Jahre zuvor eine Republik definierte, so sehr steht er im Widerspruch zur französischen und zur gesamten europäischen Wirklichkeit; denn aus dem Mittelalter heraus dominierte die Vorstellung, dass Grund und Boden Privatbesitz des Fürsten sind. Die Idee eines gemeinsamen öffentlichen Interesses, war in den vielen Jahrhunderten, die seit dem Ende der römischen Republik verstrichen waren, verloren gegangen. Bodin wiederum erklärt mit seiner Nennung der Haushaltungen als grundlegende Einheiten jegliche übergeordnete Herrschaftsansprüche für nichtig und greift somit den republikanischen Gedanken wieder auf. An die Stelle einer übermenschlichen, religiösen Rechtfertigung von Herrschaft rückt er die souveräne Regierung über eine Rechtsgemeinschaft von Einwohnern. Auf ein Wort, das Cicero noch nicht kannte, legt Bodin hierbei besonders Wert: Souveränität.
„Wer also souverän sein soll, darf in keiner Weise dem Befehl anderer unterworfen und muß in der Lage sein, den Untertanen das Gesetz vorzuschreiben, unzweckmäßige Gesetze aufzuheben oder für ungültig zu erklären und durch neue zu ersetzen.“ (ebd. S. 213)
Niemand, kein Papst und auch keine Versammlung von Fürsten kann also einem echten Souverän Vorschriften machen. Dieser allein erlässt Gesetze oder hebt sie auf. Das ist ein völlig neuer Ansatz: In Kaiser- und Königreichen, aber auch schon in der römischen Republik, waren Gesetze keine frei formulierbaren Regeln, die nur Kraft Setzung durch den Herrscher Gültigkeit beanspruchten. Gesetze bezogen ihren Gültigkeitsanspruch vielmehr aus ihrer Überlieferung von alters her. Die Rechtmäßigkeit wurde nicht durch die Autorität der Regenten verliehen, vielmehr war stets ein Bezug auf die Vergangenheit, auf Jahrhunderte alte Tradition wichtig. Hier aber sieht Bodin das Problem, weil der König, die Fürsten, die katholische Kirche und die Protestanten sich auf unterschiedliche Traditionen mit unterschiedlichen Rechtsauffassungen berufen konnten, um ihre widerstreitenden Machtansprüche durchzusetzen. Unter solchen Umständen ist kein Frieden möglich und für einen Schiedsrichter keine Grundlage vorhanden. Den Ausweg aus diesem Dilemma sieht der Jurist deshalb darin, dass es im Staat nur eine Stelle geben dürfe, die die Spielregeln festlegt und über ihre Einhaltung wacht: den Souverän. Um denselben an jene Grundlagen zu binden, denen er seine eigene Herrschaft verdankt, muss sich aber auch der er an einen Rahmen halten:
„Von den Gesetzen aber, die die Verfassung und den Aufbau des Königreichs angehen wie beispielsweise das Salische Gesetz, kann der Fürst nicht abweichen, weil sie unauflöslich mit der Krone verbunden sind.“ (ebd. S. 218)
Das hier erwähnte Salische Gesetz (lateinisch: Lex Salica), eine im 6. Jahrhundert verfasste Niederschrift mündlich überlieferter germanischer Stammesrechte, regelt die Erbfolge und damit auch die Erblichkeit der Königswürde. Hierauf beriefen sich Jahrhunderte lang die Fürsten in ihren Herrschaftsansprüchen und hierdurch wurden in Mitteleuropa Frauen von der Erbfolge ausgeschlossen. Daneben bleibt der Souverän zudem Gott und den biblischen Vorgaben gegenüber gebunden, wie Bodin betont:
„Den Gesetzen Gottes und der Natur dagegen sind alle Fürsten der Erde unterworfen und es steht nicht in ihrer Macht, sich über sie hinwegzusetzen, ohne sich eines Majestätsverbrechens an Gott schuldig zu machen und damit offen Gott den Krieg zu erklären, unter dessen Größe alle Monarchen gleichsam wie durch das Joch zu gehen und in aller Demut und Ehrfurcht ihr Haupt zu beugen haben.“ (ebd. S. 214)
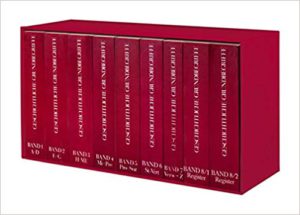
Otto Brunner u. a.: Geschichtliche Grundbegriffe
Wie gesagt, Bodin war kein Republikaner. Er wendet sich weder von der Monarchie noch von ihrem göttlichen Ursprung ab. Gott verleiht alle Macht, da weicht der Franzose nicht von der mittelalterlichen Linie ab. Aber zwischen ihm und dem Herrscher steht nichts und niemand – auch kein Papst. Bodins Souveränität wendet sich nicht gegen Gott, sondern „gegen die Aufspaltung von Herrschaft auf viele, etwa religiös, lehnsrechtlich oder ständisch legitimierte Träger“ (Koselleck/Conze u. a. 1990, S. 108). Innerhalb seines Staates ist allein der Souverän dafür zuständig, die Zuständigkeiten zu regeln, er verfügt sozusagen über die „Kompetenz-Kompetenz“ (Quaritsch 1986, S. 36). Gesetzgebung und Gestaltung des Gemeinwesens liegen in seinen Händen, und zwar für immer:
„Unter der Souveräntität ist die dem Staat [république] eignende absolute und zeitlich unbegrenzte Gewalt zu verstehen.“ (ebd. S. 205)
Könige sind sterblich, die Souveränität nicht, betont Bodin. Diese Forderung lässt sich nur auflösen, wenn man den Souverän nicht mit dem Herrscher gleichsetzt, wenn man das, worüber geherrscht wird, nicht als Privatbesitz einer Person ansieht. Die Souveränität überdauert das Leben einzelner Fürsten und repräsentiert damit eine gedankliche Einheit, eine übergeordnete Körperschaft unabhängig von einzelnen Personen oder patrizischen Familien. Ohne dass ihm selbst der Begriff zur Verfügung stand, hat Bodin damit die Idee des Staates geschaffen: eine Rechtsgemeinschaft mitsamt Bewohnern, Land und gemeinsamen Einrichtungen, um Zusammenleben und Allgemeingut zu verwalten. Geschaffen hatte er damit aber auch die Idee der unumschränkten, absoluten Herrschaft, in der der König zwar nicht mehr über Privatbesitz verfügt, dafür aber die Souveränität vorübergehend sozusagen verkörpert, weshalb 80 Jahre später der französische König Ludwig XIV. (französisch: Louis) formulieren konnte:
„L’État c’est moi!“ – „Der Staat bin ich!“
Mehr in:

Hubertus Niedermaier: Wozu Demokratie?
Hubertus Niedermaier:
Wozu Demokratie?
Politische Philosophie im Spiegel ihrer Zeit.
Konstanz und München: UVK 2017.
Literatur:
Bodin, Jean (1981): Sechs Bücher über den Staat. Buch I-III. München.
Koselleck, Reinhart / Conze, Werner u. a. (1990): Staat und Souveräntität; in: Reinhart Koselleck, Werner Conze u. a. (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Stuttgart, S. 1-154.
Quaritsch, Helmut (1986): Souveränität. Entstehung und Entwicklung des Begriffs in Frankreich und Deutschland vom 13. Jh. bis 1806. Berlin.
