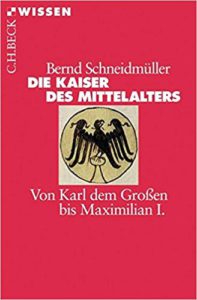Thomas Aquinas
Beginnend mit Bologna im Jahr 1088 entstanden die ersten Universitäten. Die Lehre dort stützte sich vor allem auf biblische und aristotelische Texte, sodass die Gelehrten fortan europaweit auf einer gemeinsamen Grundlage und Denkweise aufbauten. Auch in den Schriften des Thomas von Aquin (lateinisch: Thomas Aquinas), der in Neapel, Paris und Köln studiert hatte, ist der Einfluss von Aristoteles unverkennbar:
„Es ist aber die natürliche Bestimmung des Menschen, das für gemeinschaftliches und staatliches Leben erschaffene Geschöpf zu sein, das gesellig lebt, weit mehr als alle anderen Lebewesen. Schon die Notwendigkeit der menschlichen Natur gibt dafür die Erklärung. Anderen Geschöpfen hat die Natur die Nahrung bereitgestellt, die Bedeckung der Haare, Mittel zur Verteidigung, wie die Zähne, Hörner, Krallen, oder doch die Möglichkeit geschenkt, sich dem Gegner durch schnelle Flucht zu entziehen. Der Mensch aber ist mit keinem dieser Geschenke der Natur gerüstet, statt ihrer aller ist ihm die Vernunft gegeben, damit er, von ihr geleitet, imstande sei, sie sich selbst durch die Arbeit seiner Hände zu verschaffen. Aber um diese Aufgabe zu erfüllen, reicht die Kraft des einzelnen nicht hin. Auf sich allein gestellt, wäre kein Mensch imstande, das Leben so zu führen, daß er seinen Zweck erreicht. So ist es also der Natur entsprechend, mit vielen gesellig zu leben.“ (Thomas 1971, S. 5f)
Beinahe gleichlautend wurde hier die zu diesem Zeitpunkt 1500 Jahre alte Bestimmung des Menschen als geselliges Wesen vom griechischen Philosophen übernommen. Bei den Regierungsformen folgt Thomas ebenfalls dessen Einteilung in drei gute und drei schlechte Formen. Anders als sein antikes Vorbild, das von der griechischen Polis geprägt war, rückt der unter mächtigen Monarchen aufgewachsene Aquinat allerdings das Königtum an die erste Stelle. Ein Jahrhundert nach dem Investiturstreit erfährt bei ihm der Gedanke der Einheit eine besondere Betonung:
„Nun ist es aber offensichtlich, daß etwas, das in sich selbst eins ist, mehr die Einheit bewirken kann als eine Vielheit, wie etwa das, was schon in sich Wärme hat, die wirksamste Ursache der Erwärmung ist. Es ist also zweckmäßiger, wenn einer herrscht als viele.“ (ebd. S. 11)
Um der Einheit willen, solle man sogar eine Tyrannis aushalten, sofern diese „nicht zu einem besonderen Übermaß ausartet“ (ebd. S. 22). Der Glaube an den einen Gott geht hier mit der Vorstellung einher, dass auch auf Erden nur ein einziger an der Spitze stehen könne. Der republikanische Gedanke, mit dem die Römer jahrhundertelang den gesamten Mittelmeerraum zusammenzuhalten verstanden, findet keine Erwähnung mehr. Vielmehr setzt Thomas das christliche Denken in ein Plädoyer für eine klare Hierarchie um. Damit folgt der bedeutendste Theologe seiner Zeit genau der zentralistischen Ideenwelt Gregors VII. und erhebt auch wie dieser den Papst über den König:
„Im Neuen Testament aber steht das Priestertum, durch das die Menschen zu den Gütern des Himmels gebracht werden, höher, und im Gesetz, das Christus gab, müssen die Könige den Priestern unterworfen sein. Deshalb ist es nach der göttlichen Voraussicht in wunderbarer Weise geschehen, daß sich in der Stadt Rom, von der Gott vorausgesehen hatte, daß sie die Hauptstadt der Christenheit sein werde, allmählich die Sitte durchsetzte, daß sich die Führer des Staates den Priestern unterwerfen.“ (ebd. S. 56)
Ganz im Sinne Gregorius‘ hält Thomas auch die Absetzung eines Königs für möglich, denn dieser sei vom Volk gewählt und könne deshalb „von ebendemselben Volke von seinem Platze entfernt oder seine Macht eingeschränkt werden“ (ebd. S. 24). Nachdem der Aquinat zuvor noch darauf hingewiesen hatte, dass auch tyrannische Herrschaft zu erdulden sei, bleibt das hier eingeräumte Recht zur Absetzung eigentlich bedeutungslos – zumindest für das Volk. Nicht so aber für den König: Indem Thomas weltliche Herrschaftsgewalt vom Volk abhängig macht, spricht er den Fürsten zugleich ab, ihre Stellung unmittelbar von Gott empfangen zu haben. Ganz im Gegensatz zum Papst, womit dieser dem Allmächtigen näher stünde und damit Vorrang genieße. Denn die Nähe zu Gott macht den Unterschied. Sie macht unabhängig von irdischen Kräften. Eben deshalb streben Könige eine dynastische Vererbung an ihre Söhne an. Das dient nicht nur der Begünstigung der eigenen Familie, sondern löst zugleich die Abhängigkeit von menschlichen Gewalten. Was nicht irdisch ist, muss göttlich sein und etwas Gottgegebenes darf kein Mensch entziehen. Indem der Mönch eines Bettelordens nun die Absetzung durch das Volk erlaubt, trachtet er im selben Zuge danach, den Königen ihre Unmittelbarkeit zu Gott zu nehmen. Anders als bei Augustinus bleibt dann die Aufgabe der Monarchen – ganz im Sinne Aristoteles‘ – auf das Diesseits beschränkt:
„Nun müssen wir untersuchen, was für ein Land oder eine Stadt zweckentsprechender ist: von einem oder mehreren regiert zu werden. Man kann dies aus dem innersten Zweck der Herrschaft selbst entscheiden. Denn das Streben eines jeden, der eine Herrschaft ausübt, muß darauf gerichtet sein, das, was er zu regieren übernommen hat, heil zu erhalten. So ist es die Pflicht des Steuermannes, das Schiff vor den Gefahren des Meeres zu bewahren und unversehrt in den sicheren Hafen zu geleiten. Die Wohlfahrt und das Heil einer zu höherer Gemeinschaft verbundenen Menge ist es aber, jene Einigkeit zu erhalten, die man Friede nennt; ohne sie geht aller Nutzen, der aus dem Leben der Gemeinschaft erwächst, zugrunde, und die entzweite Menge wird sich selbst zur Last. Darauf muß also jeder Führer einer Menge vor allem achten, daß er das einigende Band des Friedens behüte.“ (ebd. S. 10f)
Angesichts der ständigen Auseinandersetzungen zwischen Papst, König und Fürsten kann dieser Wunsch nach Frieden nicht überraschen. Trotzdem trat auch künftig kein allmächtiger Papst oder Kaiser hervor. Im Gegenteil: Als Thomas 1274 starb, gab es bereits seit über zwanzig Jahren keinen Kaiser mehr, da die sieben deutschen Kurfürsten, die den deutschen König wählten, weiter an Macht hinzugewonnen hatten und niemand ihnen gegenüber genug Herrschaftsgewalt für kaiserliche Ansprüche erringen konnte. Am Gipfel der Macht angelangt glaubte sich dagegen Papst Bonifacius VIII. im Jahr 1302:
Bernd Schneidmüller: Die Kaiser des Mittelalters
„Daher aber erklären wir, bestimmen und verkünden wir, dass es für alle menschliche Kreatur überhaupt heilsnotwendig ist, dem römischen Papst untertan zu sein.“ (nach Schneidmüller 2006, S. 89)
Schon sieben Jahre später jedoch war der Einfluss des französischen Königs so groß, dass er den Sitz des Papstes kurzerhand von Rom ins südfranzösische Avignon verlegen konnte. 1417 war der Spuk dann wieder vorbei und die Päpste residierten fortan alle in Rom. Nicht mehr ungeschehen machen ließ sich allerdings die Auseinandersetzung und damit Spaltung zwischen Papst und Kaiser. Die Kirche versuchte ihre Geistlichen dem Zugriff der Fürsten und vor allem des Kaisers zu entziehen, wobei sie zugleich einen höheren Rang für sich beanspruchte. Andersherum strebten die weltlichen Herrscher danach, den Einfluss der Kirche so gering wie möglich zu halten und ein eigenständiges Staatswesen zu entfalten. Diese Sonderung geschah in erster Linie durch den allmählichen Aufbau voneinander unabhängiger Verwaltungsstrukturen. Weit entfernt von demokratischem Gedankengut begann dadurch eine erste Grundlage moderner Demokratie langsam sich zu entfalten: die Trennung von Kirche und Staat.
Mehr in:

Hubertus Niedermaier: Wozu Demokratie?
Hubertus Niedermaier:
Wozu Demokratie?
Politische Philosophie im Spiegel ihrer Zeit.
Konstanz und München: UVK 2017.
Schneidmüller, Bernd (2006): Die Kaiser des Mittelalters. Von Karl dem Großen bis Maximilian I. München.
Thomas von Aquin (1971): Über die Herrschaft der Fürsten. Stuttgart.